Kosten-Klarheit zur Energiewende erforderlich
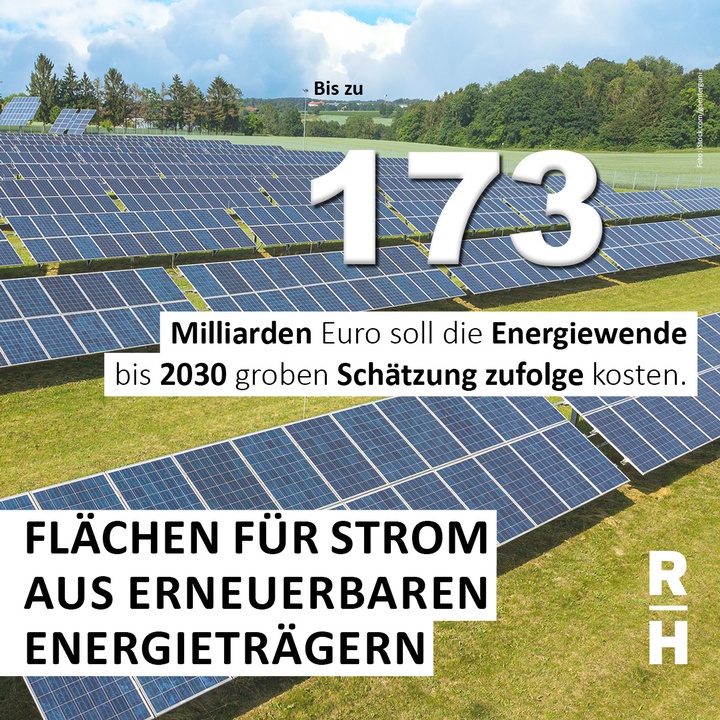
Österreich hat sich zum Ziel gesetzt, den Anteil erneuerbarer Energie zu erhöhen. Zur Frage, wie viel die Energiewende kosten wird, lag jedoch nur eine grobe, in ihren Grundlagen nicht nachvollziehbare Schätzung vor. In ihrem heute veröffentlichten Bericht „Flächen für Strom aus erneuerbaren Energieträgern“ mahnen die Prüferinnen und Prüfer des Rechnungshofes daher möglichst nachvollziehbare Berechnungen dazu ein. Mit dem Ausbau erneuerbarer Energie steigt auch der Bedarf an zusätzlichen Übertragungsleitungen und an Flächen, etwa für Photovoltaik-Anlagen. Der Rechnungshof empfiehlt, etwa im Bereich der Raumordnung entsprechende Vorkehrungen zu treffen. Flächen für Leitungstrassen gilt es frühzeitig zu sichern und freizuhalten. Geprüft wurde im Klimaschutzministerium sowie in den Ländern Niederösterreich und Oberösterreich, im Wesentlichen die Jahre 2018 bis 2022. Der am 17. Dezember 2024 beschlossene Nationale Energie- und Klimaplan (NEKP) 2024 war somit nicht Gegenstand dieser Prüfung.
Nachvollziehbare Berechnungen
In Österreich soll der Stromverbrauch (national bilanziell) ab 2030 zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen gedeckt werden. Geregelt ist das im Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz. Zudem sollte laut dem NEKP 2019 der Anteil erneuerbarer Energie am Bruttoendenergieverbrauch – also aller Energiearten wie Strom, Fernwärme, Kraftstoffe und Brennstoffe für Wärmeerzeugung – bis 2030 auf 46 Prozent bis 50 Prozent angehoben werden.
Der Rechnungshof hält kritisch fest, dass vor dem Beschluss des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes keine Abstimmung mit den Ländern über die Aufteilung der Länderbeiträge zu den Ausbauzielen stattfand. Zudem lagen keine detaillierten Informationen zu den Kosten der Energiewende vor, sondern nur eine grobe, in ihren Grundlagen nicht nachvollziehbare Schätzung. So wurde das Gesamtinvestitionsvolumen bis 2030 auf rund 166 Milliarden Euro bis rund 173 Milliarden Euro geschätzt. Davon sollten 20 bis 27 Milliarden Euro auf den Ausbau der Stromerzeugung aus erneuerbarer Energie und 6 Milliarden Euro auf den Ausbau der Stromnetze entfallen. Unklar war auch, wie sich die erforderlichen Mittel zwischen öffentlicher Hand und Privaten aufteilen.
Die Empfehlung des Rechnungshofes: Das Klimaschutzministerium soll Schätzungen zu den Kosten der Energiewende durch möglichst nachvollziehbare Berechnungen untermauern und dokumentieren.
Laut NEKP 2024 wird eine weitere Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energie auf mindestens 57 Prozent angestrebt.
Beiträge der EU-Mitgliedstaaten: Rechnungshof bemängelt Intransparenz
Die EU-Mitgliedstaaten sind verpflichtet, zum Ziel der EU beizutragen, einen bestimmten Anteil am Bruttoendenergieverbrauch durch Energie aus erneuerbaren Quellen zu decken. Die jeweiligen Beiträge legen sie im Rahmen ihres NEKP fest. In der Erneuerbare-Energien-Richtlinie RED III vom 31. Oktober 2023 wurde das EU-Gesamtziel für 2030 von 32 Prozent auf mindestens 42,5 Prozent bis 2030 erhöht. Eine weitere Erhöhung auf 45 Prozent soll angestrebt werden.
Eine Übersicht zur Höhe des Beitrags der einzelnen Mitgliedstaaten war weder auf der Website der Europäischen Kommission noch auf der Website des Klimaschutzministeriums vorhanden. Damit fehlte eine transparente Information zum jeweiligen nationalen Anteil am EU-Gesamtziel für erneuerbare Energie.
Länder und Gemeinden künftig frühzeitig einbeziehen
Angesichts der Herausforderungen für die Energieinfrastruktur durch den Ausbau erneuerbarer Energieträger erachtet der Rechnungshof die Erarbeitung des integrierten Netzinfrastrukturplans (NIP) als vordringlich. Planungsgegenstände des NIP sind insbesondere das Übertragungsnetz für Strom sowie das Fernleitungsnetz für Gas. Die Klimaschutzministerin veröffentlichte den NIP am 8. April 2024 – rund neun Monate verspätet. Der Rechnungshof kritisiert in diesem Zusammenhang unter anderem, dass das Klimaschutzministerium nach Inkrafttreten des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes im Juli 2021 die Länder erst ab November 2022 in die Abstimmungen zum NIP einbezog und die Gemeinden nicht einbezog. Er empfiehlt, die Länder sowie den Österreichischen Städtebund und den Österreichischen Gemeindebund frühzeitig in künftige Aktualisierungen des NIP einzubeziehen.
Flächen frühzeitig sichern
Im Unterschied zu anderen Staaten verfügt der Bund in Österreich über keine „Rahmenkompetenz“ im Bereich der Raumordnung. Nur durch seine sektoralen Zuständigkeiten hatte der Bund Möglichkeiten, auf gesamtstaatlicher Ebene raumplanerisch tätig zu werden. Die Niederösterreichische Landesregierung verordnete rechtsverbindliche Raumordnungsinstrumente, um Flächen für Photovoltaik und Windkraft auszuweisen und freizuhalten. In Oberösterreich lagen dafür nur Steuerungsinstrumente ohne Verbindlichkeit vor.
Aufgrund des Ausbaus erneuerbarer Energieträger besteht ein hoher Bedarf an zusätzlichen Übertragungsleitungen und somit an Flächen, die dafür erforderlich und zu sichern sind. Flächen für Leitungstrassen müssten daher frühzeitig gesichert und freigehalten werden, um die auf Bundes- und Landesebene festgelegten Ausbauziele für Stromerzeugung aus Photovoltaik, Wasserkraft und Windkraft auch umsetzen zu können.
Der Rechnungshof hält fest, dass das Land Niederösterreich keine Raumordnungsprogramme zur Freihaltung von Trassen für die zukünftige Leitungsinfrastruktur erließ. In Oberösterreich lag seit September 2022 ein Raumordnungsprogramm für die Errichtung der 220-Kilovolt-Anspeisung Zentralraum Oberösterreich vor.
Der Rechnungshof empfiehlt den Ländern Niederösterreich und Oberösterreich, zur Sicherung von Trassen für hochrangige Energieleitungen und bei entsprechenden Planungen Raumordnungsprogramme zu erlassen.
Flächenbedarf zur Erreichung der Energieziele unklar
Weder dem Klimaschutzministerium noch dem Land Oberösterreich lagen Daten zur Flächeninanspruchnahme vor, die nötig wäre, um die Energieziele erreichen zu können. Das Land Niederösterreich setzte sich mit dem Bedarf an Freiflächen für Photovoltaik-Anlagen zur Erreichung seiner Energieziele gemäß dem NÖ Klima- und Energiefahrplan 2020 bis 2030 sowie dem Flächenbedarf für Windkraft-Anlagen auseinander.
Um die Ziele 2030 für die Stromerzeugung aus Photovoltaik-Anlagen zu erreichen, sind auch nach Berücksichtigung der Potenziale auf Gebäuden große Freiflächen erforderlich: österreichweit zwischen 51 und 184 Quadratkilometer, in Niederösterreich bis zu 17 Quadratkilometer und in Oberösterreich bis zu 25 Quadratkilometer. In Niederösterreich müsste sich die Stromerzeugung aus Photovoltaik zur Erreichung der Landesziele bis 2030 gegenüber 2022 etwa verdreifachen, in Oberösterreich etwa vervierfachen.
Zum gesetzlich vorgegebenen Ziel, eine Million Dächer mit Photovoltaik auszustatten, hält der Rechnungshof kritisch fest, dass das Klimaschutzministerium dieses – mangels Datengrundlagen – nicht überwachen konnte. Zudem ließ die Anzahl der Dächer mit Photovoltaik keine Aussage zur erzeugten Energiemenge zu. Laut Regierungsprogramm 2020–2024 sollten Flächen im direkten oder indirekten Eigentum des Bundes für erneuerbare Energie genutzt werden. Doch das Klimaschutzministerium hatte keinen Überblick über Anlagen für erneuerbare Energieträger auf Gebäuden beziehungsweise Flächen des Bundes.
Ausblick: Klimaneutralität bis 2040
Die vom Klimaschutzministerium beauftragte Studie „Energie- und Treibhausgas-Szenario Transition 2040“ analysierte, ob beziehungsweise wie das Ziel der Klimaneutralität bis 2040 erreicht werden könnte. Bei Weiterverfolgung dieses Szenarios wäre ein Ausbau der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energieträgern erforderlich, der über die bisherigen Energieziele hinausgeht. Der Rechnungshof empfiehlt, auf die (volks-)wirtschaftlichen Auswirkungen, zum Beispiel Inflationsfolgen, zu achten. Dies vor dem Hintergrund, dass die durchschnittliche Inflationsrate von 2031 bis 2040 für das „Energie- und Treibhausgas-Szenario Transition 2040“ um rund ein Drittel über der Inflationsrate von zwei Prozent liegt, die von der Europäischen Zentralbank mittelfristig angestrebt wird.
Presseinformation: Flächen für Strom aus erneuerbaren Energieträgern
- pdf Datei:
- 3,856.2 KB
- Umfang:
- 110 Seiten
Bericht: Flächen für Strom aus erneuerbaren Energieträgern
Der Rechnungshof überprüfte von Jänner bis September 2023 im Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie sowie in den Ländern Niederösterreich und Oberösterreich die Standortplanung und Flächensicherung für Strom aus erneuerbaren Energieträgern mit Schwerpunkt auf Photovoltaik und Windkraft. Ziel der Gebarungsüberprüfung war,
• die wesentlichen Rechtsgrundlagen, Strategien und Ziele,
• die Potenziale und Planungen,
• die Steuerung und Koordinierung der Standortplanung und Flächensicherung sowie
• die Erzeugung von Energie auf öffentlichen Gebäuden und Flächen im Überblick
darzustellen und zu beurteilen.
Der überprüfte Zeitraum umfasste im Wesentlichen die Jahre 2018 bis 2022.


