Österreich hat keine fertiggestellte gesamtstaatliche Blackout-Strategie
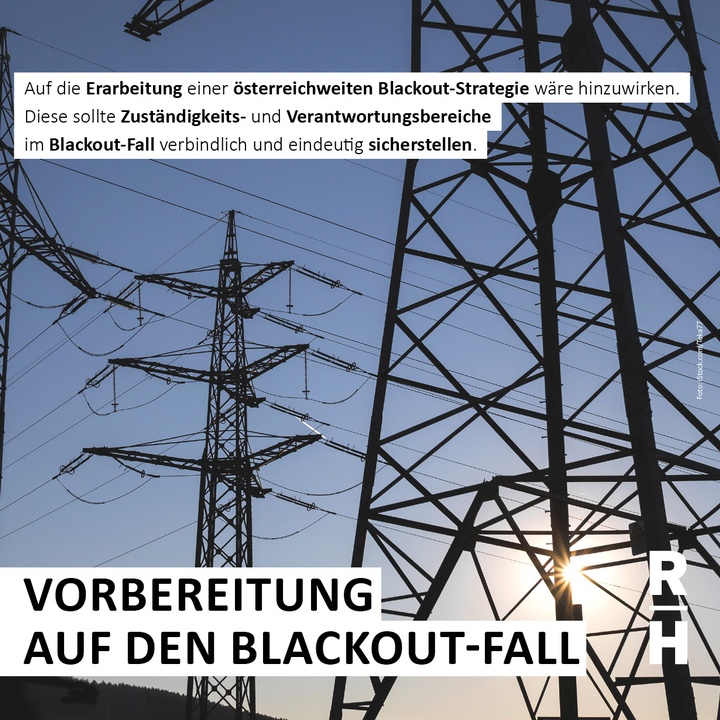
Alle österreichischen Gebietskörperschaftsebenen haben Vorbereitungen für einen Blackout-Fall getroffen – jedoch sind diese unterschiedlich intensiv und unterschiedlich weit fortgeschritten. So fehlt ein gesamtstaatlicher Blackout-Plan zur Information und Kommunikation. Das zeigen die Prüferinnen und Prüfer des Rechnungshofes im heute veröffentlichten Bericht „Vorbereitung auf den Blackout-Fall“ auf. Geprüft wurde auf Bundesebene unter anderem beim Innen- und beim Verteidigungsministerium; auf Landesebene im Land Steiermark und auf Gemeindeebene in der Stadtgemeinde Feldbach. Der Rechnungshof empfiehlt, die Vorbereitungsmaßnahmen für einen Blackout-Fall regelmäßig auf ihre Eignung zu überprüfen und sie zu optimieren. Der überprüfte Zeitraum umfasste im Wesentlichen die Jahre 2018 bis 2023.
Einheitliche Blackout-Begriffsdefinition für Klarheit im Anlassfall
Ein überregionaler, plötzlich auftretender Stromausfall, gefolgt von Infrastruktur- und Versorgungsausfällen: Bei einem Blackout sind keine angrenzenden Gemeinden, Bezirke und Bundesländer stromversorgt. Ein Blackout ist von regionalen Stromausfällen oder einer Strommangellage zu unterscheiden. In diesen Fällen ist eine (externe) Hilfeleistung aus stromversorgten Gebieten möglich. Wohingegen bei Blackouts auch angrenzende Gebiete ohne Strom sind. In einem derartigen Szenario muss auch mit dem Wegfall gewohnter Kommunikationsmöglichkeiten wie Handy oder Internet gerechnet werden. Ebenso eingeschränkt sind die Mobilität und die Versorgung mit Alltagsgütern.
Aus Sicht des Rechnungshofes ist ein durchgängiges und einheitliches Verständnis von Blackout maßgeblich, um die Resilienz der staatlichen Verwaltung in Krisenfällen zu erhöhen. Er weist darauf hin, dass das Verständnis der Länder dahingehend unterschiedlich war, bei welcher Dauer und bei Ausfall welcher Komponenten ein Blackout vorlag. Dies könnte im Anlassfall zu Unsicherheiten und Unklarheiten führen und ein uneinheitliches Vorgehen nach sich ziehen.
Vorbereitungsmaßnahmen regelmäßig überprüfen und optimieren
Zur Zeit der Rechnungshofprüfung waren einzelne Blackout-Maßnahmen noch nicht voll ausgearbeitet, andere weit fortgeschritten oder in Umsetzung. Gemeinsam waren auf allen überprüften Körperschaftsebenen die Bestimmung von blackout-relevanten Aufgaben und dafür erforderliches Personal. So definiert im Land Steiermark beispielsweise jede Landesdienststelle für sich, welche Aufgaben sie als blackout-relevant erachtet. Das Innenministerium definiert die Aufgabenstellungen zentral auch für die nachgeordneten Dienststellen.
Im Land Steiermark obliegt es der Leitung der Landesdienststellen, das benötigte, qualifizierte Personal zu benennen und zuzuteilen. Das Außenministerium legt fest, dass sich Personal bestimmter Organisationseinheiten im Blackout-Fall in der Zentralstelle in Wien einzufinden hat.
Bei der Auswahl von blackout-relevantem Personal ist darauf zu achten, nur jene Personen zur Dienstleistung aufzufordern, die zur Aufgabenerfüllung notwendig sind – um etwa vermeidbare Verkehrsströme zu minimieren. Dabei sollten auch die persönlichen Lebensumstände und die Entfernung zum Arbeitsort bedacht werden.
Vorbereitungsmaßnahmen wie diese sind daher in regelmäßigen Abständen auf ihre Eignung zu überprüfen und interministeriell sowie im Austausch mit anderen Gebietskörperschaftsebenen zu optimieren. Ebenfalls wichtig ist eine regelmäßige Neubeurteilung blackout-relevanter Aufgaben.
Österreichweite Blackout-Strategie und vordefinierte Kommunikationswege ausständig
Das Staatliche Krisen- und Katastrophenschutzmanagement (SKKM) ist unter anderem zuständig für die Zusammenarbeit beziehungsweise die Koordination der Maßnahmen sowohl bei der Vorsorge wie auch bei der Abwehr und Bewältigung von Katastrophen.
Im Dezember 2022 richtete der SKKM-Koordinationsausschuss eine Fachgruppe zum Thema Blackout ein. In dieser waren die Länder, die Bundesministerien und weitere Stellen – wie etwa Einsatzorganisationen und Medien – vertreten, um eine Blackout-Strategie zu erarbeiten. Neben der uneinheitlichen Blackout-Begriffsdefinition waren auch die behördeninterne Kommunikation beziehungsweise der Kommunikationsweg je nach Land verschieden.
Die Zuständigkeiten und Kommunikationswege sollten im Voraus definiert werden, um in der Katastrophensituation keine Zeit zu verlieren, so die Empfehlung des Rechnungshofes. Die Rahmenbedingungen sollten – einem Automatismus gleich – ohne weitere Entscheidungssuche angewendet werden.
(Krisen-)Kommunikationssysteme ausreichend gewährleisten
Eine bundesweite Übung zur Kommunikation in der Krise fand in Österreich bisher nicht statt. Eine Übung mit diesem Schwerpunkt ist für den Blackout-Fall unerlässlich, um eine unkoordinierte und widersprüchliche Kommunikation im Krisenfall zu vermeiden.
Im Rahmen des SKKM-Koordinationsausschusses wurden jedoch schon Schritte und Maßnahmen zum Aufbau einer krisenresistenten und auch im Blackout-Fall funktionierenden Kommunikation gesetzt. Die Funktion der relevanten (Krisen-)Kommunikationssysteme wäre – zumindest für jene Zeitspanne, die zur Wiederherstellung der Stromversorgung erwartet wird – zu gewährleisten.
Erkenntnisse aus den von der Stadtgemeinde Feldbach gesetzten Maßnahmen
Feldbach ist die fünftgrößte Stadt der Steiermark und auf Gemeindeebene ein Vorreiter bei Blackout-Vorbereitungen. Die Stadtgemeinde setzte ihre umfangreichen wissenschaftlich begleiteten Vorbereitungsmaßnahmen großteils bis September 2023 um.
Dazu gehören: die Stärkung der Eigenvorsorge der Bewohnerinnen und Bewohner; die Einrichtung von elf notstromversorgten fußläufig erreichbaren Selbsthilfebasen verteilt auf das gesamte Gemeindegebiet; die Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Infrastruktur und relevanter Betriebe; die gesicherte Treibstoffversorgung durch eine notstromversorgte Tankstelle; und die Gewährleistung der Kommunikation und Information.
Aus Sicht des Rechnungshofes sind diese Maßnahmen geeignet, die Resilienz Feldbachs im Fall eines Blackouts zu erhöhen. Er betont am Beispiel der Stadtgemeinde, dass die auf Ebene der Einzelperson erreichte Resilienz bei einem Blackout die der nächsthöheren Ebene stärken kann. Die Erkenntnisse aus den von der Stadtgemeinde Feldbach gesetzten Maßnahmen sollten demnach österreichweit berücksichtigt werden.
Presseinformation: Vorbereitung auf den Blackout-Fall
- pdf Datei:
- 2,927.3 KB
- Umfang:
- 98 Seiten
Bericht: Vorbereitung auf den Blackout-Fall
Der Rechnungshof überprüfte von März 2023 bis Juli 2023 die geplanten und getroffenen Maßnahmen zur Vorbereitung auf den Fall eines Blackouts. Ziele der Gebarungsüberprüfung waren insbesondere die Darstellung und Beurteilung nationaler und internationaler rechtlicher Grundlagen und Zuständigkeiten sowie die vergleichende Darstellung der Vorbereitungsmaßnahmen der überprüften Stellen.


